Artikel aus August 2019
Am 18. September 1848, um 1/2 12 Uhr mittags, wenige Tage nach dem damaligen Ende des Schuljahres, starb der Lehrer, Messner und Organist Vincenz Schwarz an Verblutung infolge eiternder Gefäße. „Er wurde am 26. November 1795 geboren, war der Sohn des hiesigen Messners und Hausbesitzers Nr. 37. Er absolvierte im Jahre 1815 den pädagogischen Lehrkurs in Villach mit ausgezeichnetem Erfolg und wirkte durch volle 33 Jahre als Lehrer, Messner und Organist in Gmünd.“
Seine Eltern waren Mathias Schwarz, Stadtpfarramtsmessner und Helene Schwarz, eine geborene Mayer. Am 11. Februar 1828 heiratete Vinzenz in Gmünd seine Frau Elisabeth Hopfgartner, „die Tochter des Christian Hopfgartner, gewesener Besitzer des Aichholzer Gutes zu Mühldorf und dessen Eheweibes, einer geborenen Rauniggin. Elisabeth war dermalen bey Herrn Wallner allhier als Kellnerin in Dienst gestanden.“

Vinzenz war damals angestellter Lehrer der zweiten Klasse in unserer Stadtschule, aber auch Stadtpfarramtsmesner, Organist und Kantor. Getraut wurden sie vom damaligen Probst, Dechant und Stadtpfarrer Leopold Anton Praskowitz. (Dieser ließ aus Sühne für einen erschossenen Franzosen das Gemälde rechts vom Kircheneingang malen.)
Beistände waren Johann Wallner, bürgerlicher Braumeister, Wirth und Gastgeb – der Chef der Braut – sowie sein Lehrerkollege Ignatz Stiegler, geb. am 22. September 1821 in Millstatt als Sohn des Ignatz Stiegler, bürgerlicher Lederermeister und Bäckermeister und dessen Frau Maria, geborene Hopfgartner aus Mühldorf.
Vinzenz Schwarz muss ein sehr angesehener und beliebter Schulmann gewesen sein. Das Begräbnis leitete der Stadtpfarrer und Dechant Heinrich Hermann gemeinsam mit dem Gmünder Kaplan, dem Pfarrer von Malta und dem Kaplan von Lieseregg – fast ein Staatsbegräbnis! Sein Nachfolger schrieb über ihn:
„Die große Anzahl von Collegen seiner Umgebung, von Schülern, sowie Verwandten, Freunden und Verehrern des Heimgegangenen lieferten den sprechenden Beweis, in welch hoher Achtung der Verstorbene gestanden. Ohne alle Selbstüberschätzung, offen und dienstfertig gegen jedermann, rechtschaffen in seinem Handeln, war er ein wahrer Vater seiner Schüler und überhaupt ein vorzüglicher Pädagoge.“ Beschrieben wird er als kräftiger, hochgewachsener Mann, der neben der Orgel auch Violine spielte und diese auch unterrichtete.
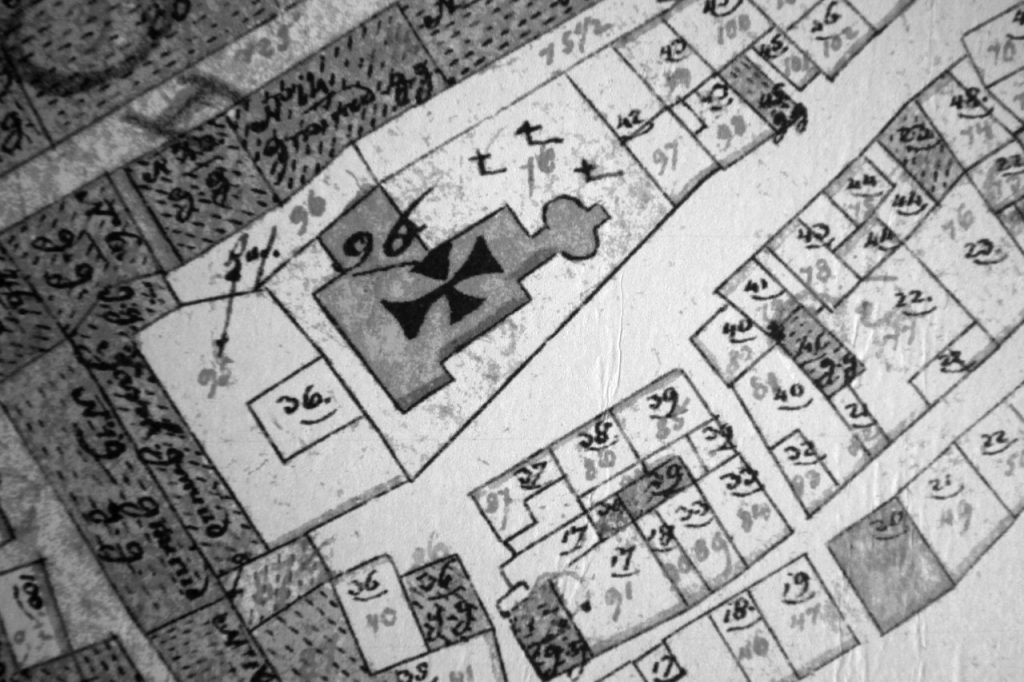
Als Nachfolger für die erledigte Stelle wurde sein Beistand Ignaz Stiegler bestimmt und mit Dekret angestellt. Der zweite Lehrer zur damaligen Zeit war Johann Unterkräuter. Zweitlehrer – „Unterlehrer“, wie sie damals genannt wurden – mussten oft die Stelle wechseln, und so kam auch Unterrieder nach einem halben Schuljahr nach Malborgeth. Sein Nachfolger, Johann Adam, blieb ein Jahr und kam anschließend nach Obermillstatt. An seine Stelle kam Johann Kerschbauer, dem ein halbes Jahr später der Lehramtskandidat Josef Leinthaler nachfolgte. Diese Aufstellung soll zeigen, dass es für die betroffenen Kinder sicher nicht einfach war, sich ständig auf einen neuen Lehrer einzustellen.
Im Juni 1853 wurden die Schulen des Gerichtsbezirkes Gmünd inspiziert. Das wäre nicht weiter erwähnenswert, solche Inspektionen hat es im Schuljahr öfters gegeben. Dieses Mal erwähnt der Chronist eine Besonderheit: Der Schulleiter wurde mittels Erlasses des k.k. Unterrichtsministeriums vom 16.6.1854 informiert, dass der Herr Inspektor mit den Fortschritten der Schüler vollkommen zufrieden war.

Über den gegenwärtigen Zustand Gmünds schreibt der Chronist: „Gmünd hat (1892) 950 Einwohner und der Schulsprengel umfasst die Ortschaften: Gmünd, Waschanger, Moos, Kreuschlach, Treffenboden, Unterbuch, Gries, Holztratte, Schloßbichl, Karnerau, Landfraß und Riesertratte. Die Bewohner beschreibt er als Handwerker, Gastwirte und Kaufleute, teils Realitätenbesitzer.
Öffentliche Gebäude waren das Schulgebäude, das k.k. Bezirksgericht und das Dechantgebäude. Von Denkmälern befindet sich eines am Hauptplatze, zur Erinnerung an die Pest, welche gegen Ende des vorigen Jahrhunderts hier grassierte.“ (Anmerkung: Da hat sich der Herr Kollege wohl nicht die Mühe gemacht, den Text zu lesen, der in Stein gemeißelt an das große Erdbeben im Jahre 1690 erinnert!)
Das zweite Denkmal, das heute am Hauptplatz zu sehen ist, der Hl. Nepomuk, wurde 3 Jahre später von der Maltabrücke auf den Hauptplatz überstellt. Der Grund ist nicht überliefert, aber es war ein Glücksfall, denn beim großen Hochwasser 1903 wäre die Statue wohl zerstört worden.
Von Wohltätigkeitsanstalten ist das Bürgerspital zu nennen, an Behörden gab es das k.k.
Bezirksgericht, das Gemeindeamt, das Steueramt und ein Bolletierungsamt in dem Bescheinigungen über die Einhebung der Verzehrsteuer, Wege- und Brückenmaut ausgestellt wurden.
Über den gegenwärtigen Zustand der Schule erfahren wir: Das neue Schulhaus wurde am 24. Mai 1880 eröffnet. Die Einweihung desselben nahm Hr. Dechant Kornke vor. Nach dem Einweihungsakt wurde vom MGV „Die Ehre Gottes“ gesungen, worauf Hr. Lax im Namen der Gemeindevorstehung die Festgäste begrüßte und dem Ortsschulrat die Schlüssel des Schulhauses übergab. Im Namen des Ortsschulrates sprach Hr. v. Jäger. Hierauf hielt Bezirksschulinspektor Benedicter die Festrede, in welcher er vor allem der Freude Ausdruck gab, dass ein Bau seiner Bestimmung übergeben wurde, an den das leibliche und geistige Wohl der hiesigen Stadt von Jahrzehnten, ja Jahrhunderten geknüpft ist.
„Haben Sie Dank“, sprach er, „für die Umsicht, mit der Sie dieses Werk vollendet haben. Welch trauriges Los harrte früher der Jugend, wenn sie zusammengepfercht des Tages 4 – 6 Stunden in den niedrigen, engen Schulräumen zubringen mussten. Mit welch anderen Gefühlen können wir jetzt die Kinder zur Schule ziehen sehen. Diese hohen, luftigen Räume, die sorgfältig angebrachte Ventilation, die bequemen Bänke etc. – sie werden jede Gefahr für die Gesundheit ausschließen, die Schule wird den Kindern ein liebliches Heim werden, dem sie mit Freuden zueilen!“
Zu den Kindern sprach er: „Seid achtsam in den Lehrstunden; denn dann wird das Lernen Euch keine Last, sondern eine Lust sein! Seid fleißig; denn dann werdet ihr alle die Kenntnisse erwerben, durch die ihr euch einstens eine sichere Existenz erwerben könnt. So werdet Ihr euch selbst ein angenehmes Leben bereiten, aber auch mit Wohlgefallen, Freude und Stolz werden auf euch herniederschauen eure Eltern, Lehrer, alle Bürger der Stadt, und selbst Gottes Auge wird segnend auf euch ruhen!“
Auch Sponsoring gab es damals schon: Der Bezirksschulrat gab unter 21.2.1883 der Schulleitung
bekannt, dass das hohe k.k. Ackerbauministerium 18 Exemplare landwirtschaftlicher Werke der hiesigen Schule gespendet habe. Dieselben sind der Schulbibliothek einverleibt worden.
In den Schulchroniken gab es früher eine eigene Spalte, in der besondere Wetterereignisse eingetragen werden mussten. Einige seien hier angeführt:
Am 8. Jänner 1895 ist ein 45 cm hoher Schnee gefallen.
In der Nacht vom 14. auf den 15. April 1895 fand ein Erdbeben statt.
In der Nacht vom 11. auf den 12. Mai 1897 fiel ein 35 cm hoher Schnee und verursachte an den blühenden Obstbäumen großen Schaden.
Am 16. Februar 1901 war eine Temperatur von -27,6° C.
Am 11. März fiel ein mit afrikanischem Wüstenstaube gemengter Schnee.
Nicht ganz 100 Jahre wurden Kinder im neu erbauten Schulhaus unterrichtet. Bis zur Eröffnung der Hauptschule auch die 10- bis 14-Jährigen. Landwirtschaftliches Wissen wurde vermittelt, Pflanzenbau, die Kunst des Veredelns von Obstbäumen, aber auch Werken, für die Mädchen gab es Hauswirtschaftsunterricht.
Viele Gmünder hatten Tränen in den Augen, als sie sahen, wie diese schöne Schule der „Spitzhacke“ zum Opfer fiel. Aber die „neue Zeit“ erforderte wohl den Neubau. Als langjähriger Lehrer darf ich sagen, dass die Unterrichtsmöglichkeiten in der neuen Schule doch vielfältiger sind, als sie es früher waren.

